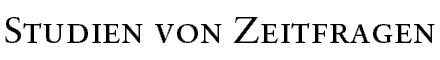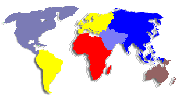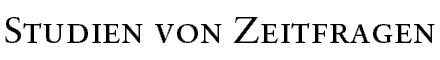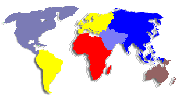Ratlose Zauberlehrlinge Die Politik verliert gegenüber der Wirtschaft an Einfluss.
Doch auch die Unternehmer sind Getriebene Von Edzard Reuter (in DIE ZEIT 1999 Nr. 50) Ich frage mich, ob Wirtschaft und Politik inzwischen ihre tradierten Rollen vertauscht haben. Viel drastischer, als ich
selbst dies wagen dürfte, schrieb neulich Günter Grass in der ZEIT: »Nicht mehr die gewählte Regierung, kein Kanzler bestimmt die Richtlinien der Politik: An ihrer Stelle herrschen unlegitimiert die Vorstände der gebündelten und sich global verflüchtigenden Wirtschaftsmacht: (...) Was ist das Papier noch wert, auf dem unsere Verfassung steht, wenn ihm tagtäglich, gepaart mit Drohgebärden - ’Entweder gibt die Regierung nach, oder wir wechseln den Standort’ - Hohn gesprochen wird?« Starker Tobak. Doch können wir nicht, zumindest in der Bundesrepublik, aber auch in anderen westlichen Ländern, täglich neu verfolgen, wie schnell die Regierenden einknicken, wenn sie von den Verbandsvertretern der Wirtschaft, von maßgeblichen Moguln bestimmter Branchen oder von einzelnen wichtigen Großunternehmen unter Druck gesetzt werden? Sprechen nicht tatsächlich viele Anzeichen dafür, dass der
Primat der Politik in Gefahr gerät? Die Sorge des zornigen Dichters darf also nicht einfach abgetan werden. Trotzdem wäre es zu kurz gesprungen, sie nicht zu hinterfragen: Es geht schlicht darum, ob die Unternehmer eigentlich noch Treiber des Geschehens sind oder vielmehr Getriebene im Wettbewerb nicht nur um ihre Kunden, sondern auch um ihre Geldgeber - ausgeliefert an Gesetzmäßigkeiten, die sich längst, wiewohl ursprünglich herbeigesehnt, verselbstständigt haben wie der
Besen in der Ballade von Johann Wolfgang von Goethe. Der Eindruck, es handele sich bei der überwiegenden Zahl der heutigen Unternehmer um Getriebene, liegt nahe. Wer es nicht schafft, den Aktienkurs seines Unternehmens zumindest im gleichen Ausmaß zu steigern wie der Wettbewerber, muss um seinen Posten fürchten. Er scheint zum Gefangenen eines ursprünglich von den USA ausgehenden, dann von der City of
London bejubelten und inzwischen an allen Finanzplätzen der Welt als Dogma verkündeten Systems geworden, wonach dem ökonomischen Geschehen volle Autarkie gegenüber allen gesellschaftlichen, politischen und letztlich auch staatlichen Einbindungen zukommt. In Wirklichkeit kann der Wert eines Unternehmens mit allem Möglichen, nur ganz sicher nicht allein mit der Latte des Aktienkurses gemessen werden. Trotzdem scheint die
Selbstauslieferung an die Börse unaufhaltsam, ja, einer großen Mehrzahl von Unternehmern ist sie sogar willkommen. Legion sind die amerikanischen Chefs, die auf diesem Weg als Gegenleistung für ihre Tätigkeit binnen drei oder vier Jahren Vermögen bis zum dreistelligen Millionenbereich ansammeln konnten. Bei einem späteren Zusammenbruch ihres Unternehmens können sie auch fürderhin ein Leben in Saus und Braus genießen. Verwunderlich ist es da nicht, dass
deutsche Kollegen ihnen nachzueifern versuchen. Behauptet wird immer wieder, dass das alles durch die Globalisierung der Weltwirtschaft bedingt wird. Tatsächlich handelt es sich um ein Bündel von Vorgängen, deren Auswirkungen zwar keineswegs gottgewollt und unbeeinflussbar sind, denen sich aber nur die wenigsten entziehen können: Weltweit hat das Bruttosozialprodukt in jedem einzelnen Jahrzehnt seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges in einem Ausmaß zugenommen, das demjenigen der gesamten vorausgegangenen Geschichte der Menschheit entspricht. Zugleich ist die Weltbevölkerung von etwas über drei auf demnächst acht Milliarden Menschen angewachsen. Begleitet wird das von einer Explosion des Warentransportes, aber auch des Personenverkehrs rund um die Erde. Die Telekommunikation sorgt (unwiderruflich) dafür, dass der gleiche Wissensstand jedermann fast zeitgleich zugänglich ist.
Nicht weniger bedeutsam als die Wissensverbreitung ist die weltweite Verknüpfung und Liberalisierung der Finanzmärkte; allein über die Währungsmärkte werden täglich Transaktionen im Gegenwert von etwa 1500 Milliarden Dollar abgewickelt, mehr als 90 Prozent davon entfallen auf reine Finanzgeschäfte. Wenig mehr als 3000 internationale Fondsgesellschaften - als institutional investors bekannt - verwalten heute ein Anlagekapital von 1200 Milliarden Mark. Sie halten damit über
die Hälfte des in den Vereinigten Staaten an den Börsen notierten Kapitals. Zugleich verändern die weltweit tätigen Unternehmen ihren Charakter. Sie beginnen, ihre Multinationalität - im Sinne eines wohlorganisierten Zusammenspiels von ziemlich selbstständigen, sich als good corporate citizens verstehenden Geschäftseinheiten in einem jeweils nationalen Umfeld - zur Transnationalität zu wandeln, indem sie sich nach und nach
von ihren ursprünglichen Kernstandorten, ihren Heimatländern, lösen. Noch erwirtschaften die weltweit tätigen Unternehmen etwa drei Viertel ihrer Wertschöpfung an ihren ursprünglichen Standorten. Doch die Investitionen der 100 größten Konzerne werden bald zu fast zwei Dritteln außerhalb der Heimatstandorte getätigt werden. Wachsende Transnationalität wird die Folge sein, vorangetrieben auch
durch die - nicht zuletzt im Interesse der beteiligten Investmentbanken liegende - Vermehrung von Mammutfusionen. Bedenkt man Tempo und Dimension solcher Vorgänge, stellt sich die Frage, ob nicht ein wesentlicher Teil der internationalen Finanzmärkte - und mit ihnen der gesamten Ökonomie - tatsächlich in etwas eingebunden ist, das Naturwissenschaftler als geschlossenes System bezeichnen
würden. Ähnlich einem Teufelskreis ist ein solches System dadurch gekennzeichnet, dass es ausschließlich seinen eigenen Gesetzen folgt, seine Abläufe also von außen kaum zu beeinflussen sind. Deswegen gerät es in Gefahr, sich eigenständig zu beschleunigen, gleichsam wie eine Lawine den Hang herabzurasen - und vielleicht droht just diese Lawine den für uns alle lebenswichtigen Primat der Politik hinwegzuraffen. Beteiligt an diesem vermuteten System sind drei Gruppen von
Akteuren: die als institutionelle Anleger bereits erwähnten Pensionsfonds und Versicherungen; die Banken; und die Geschäftsführung der international tätigen Unternehmen. Sie alle arbeiten in die gleiche Richtung, ohne dass ihnen nennenswerte Zügel angelegt sind. Ihr gemeinsames Ziel lautet, ständig die Börsenkurse zu steigern - denn nur so lange, wie dies ohne gravierende Rückschläge gelingt, kann das System vor schweren Verwerfungen, womöglich gar vor
Katastrophen bewahrt bleiben. Der dahinter steckende Mechanismus ist leicht zu beschreiben. Die institutional investors verwalten unvorstellbar große Vermögensbeträge, die aus den Einzahlungen von Millionen Menschen für ihre Altersvorsorge und ihre Lebensversicherung stammen. Überwiegend sind diese Gesellschaften in den angelsächsischen Ländern zu Hause. Doch auch in den anderen Teilen der Welt, nicht zuletzt in Westeuropa,
gewinnen sie an Boden. Ihr oberstes Ziel ist eine laufende Wertsteigerung, die vor allem den Altersbezügen der Teilnehmer zugute kommen soll. In den vergangenen Jahren standen dabei die Aktien von börsennotierten Unternehmen im Mittelpunkt des Interesses. Der Erfolg des Systems setzt aber eben voraus, dass der am Börsenkurs gemessene »Wert« jener Unternehmen ständig zunimmt, deren Aktien man im eigenen Portefeuille hat. Ob ein
solcher Anstieg des Börsenwertes für die langfristige Existenz der betreffenden Unternehmen förderlich ist oder nicht, braucht die Anleger wenig zu interessieren: Sie können sich jederzeit wieder aus dem Staub machen, indem sie sich - mit Gewinn - von ihrem Aktienbesitz trennen. Die Besteuerung solcher Gewinne ist fast weltweit abgeschafft oder auf ein marginales Maß reduziert worden. Folgerichtig scheuen sich etliche institutional investors längst nicht mehr, auf allen
möglichen Wegen Druck auf die Geschäftsleitungen auszuüben: sie zu Schritten zu veranlassen, die ausschließlich im Interesse einer kurzfristigen Vermögensmehrung liegen. Uwe Schneider hat deswegen zu Recht die Frage aufgeworfen, ob wir uns auf dem Weg in einen »Pensionskassenkorporatismus« befinden. Manche Beobachter meinen, dass rund 200 Chefs dieser institutionellen Anleger über das Wohl und Wehe der wichtigsten amerikanischen Unternehmen bestimmen, wobei ihre gesetzliche
Verantwortlichkeit kaum ins Gewicht fällt. An diesem Drehpunkt nun setzen die Interessen der internationalen Banken ein. Die Ära ist zu Ende, in der sie ihr Geld vornehmlich durch die Vergabe von Krediten verdienten. Heute leben sie zum großen Teil von Provisionseinnahmen. Deren Höhe wiederum wird beeinflusst durch den Handel mit Wertpapieren und Währungen auf der einen, die Mitwirkung an
dem Kauf und Verkauf von Beteiligungen oder an Zusammenschlüssen auf der anderen Seite. Die Umschichtung von Aktienanlagen durch die institutionellen Anleger kann den Börsenkurs eines Unternehmens genauso beeinflussen wie der Verkauf eines Teilbereichs oder ein Übernahmeangebot für einen Konkurrenten. Mithin sitzen die Investoren und die Banken im selben Boot. Immer öfter gibt es weitere Insassen: eben die Vorstandsmitglieder der
betroffenen Unternehmen und die übrigen Mitwirkenden in der obersten Geschäftsleitung. Ihr persönliches Einkommen wird ebenfalls durch die Entwicklung des Aktienkurses bestimmt; sie brauchen sich über die weitere Zukunft des Unternehmens oder gar über Arbeitsplätze der dort beschäftigten Menschen kaum mehr Sorgen zu machen. Damit schließt sich der Kreis. Das System funktioniert, solange
das Börsenspiel stetig steigende Kursgewinne abwirft. Freilich kann es selbst in einer friedlichen Welt und bei einem von jeglichen Verwerfungen freien Wachstum der Wirtschaft schnell ein böses Erwachen geben. Auch wenn man alle ethischen und moralischen Fragen beiseite lassen wollte: Es liegt auf der Hand, dass unübersehbare Probleme spätestens dann auftauchen, wenn die anlagesuchenden Geldmittel der institutionellen Investoren eines Tages den realen Wert der für
die Anleger zur Verfügung stehenden Unternehmen übersteigen sollten. Verlässliche Schätzungen weisen aus, dass der Gesamtwert der an den Börsen der Welt gehandelten Aktien seit 1980 um mindestens 1000, wenn nicht um nahezu 1500 Prozent zugenommen hat - verglichen mit einem Anstieg der Wirtschaftsleistung in den traditionellen Industriestaaten nur um knapp mehr als die Hälfte. Unzählige Beispiele zeigen, wie
sich der so definierte Wert einzelner Unternehmen binnen weniger Monate nach der Börseneinführung vervielfachte. Kürzlich ist der Wert der Deutschen Telekom an einem einzigen Börsentag um 20 Milliarden Mark gestiegen. Selbst dem blauäugigsten Anbeter des marktwirtschaftlichen Systems wird es ein wenig schwer fallen, solche Entwicklungen mit einer entsprechenden Substanzmehrung des Unternehmens oder allein mit der Qualität des dahinter stehenden unternehmerischen Handelns zu erklären.
Im Anklang an jene Immobilienseifenblase, die das fernöstliche Bankensystem in seinen Grundfesten erschütterte, wird das Problem in den USA längst als asset price bubble diskutiert. Kann noch irgend jemand den Verdacht von sich weisen, dass wir es schon heute an den Börsen der Welt mit einer Aktienseifenblase zu tun haben? Haben Marx und Engels ihre Finger nicht doch in die richtige
Wunde gelegt? Sogar der Financial Times kommt es inzwischen bemerkenswert vor, dass etwa die Aktie des Hauses Goldman Sachs am ersten Tag ihrer Börsennotierung um 40 Prozent über dem Ausgabekurs gehandelt wurde, dem Zwanzigfachen des Jahresgewinnes und fast dem Fünffachen des Buchwertes. Und jeder, der seine Augen schon einmal ein wenig über den Tellerrand hinaus gerichtet hat, kennt jenes bemerkenswerte Unternehmen Amazon.com, das an der Börse mit 20 Milliarden
Dollar bewertet wird, obwohl es noch nie in seiner jungen Geschichte einen einzigen Cent verdient hat. Sollte die Seifenblase eines Tages platzen, wird es um weit mehr als den Katzenjammer der unmittelbar Beteiligten gehen. Hoffentlich wird nicht erst dann - nämlich zu spät - all jenen Akteuren der Politik und der Wirtschaft, für die der Begriff Verantwortung etwas anderes als eine leere Worthülse
bedeutet, klar werden, dass die Entwicklung zu einer Erosion der traditionellen Grundlagen ökonomischer Steuerung durch autonome Nationalstaaten geführt hat. Den Scherbenhaufen werden sie dennoch vor ihrer eigenen Tür - nirgendwo sonst - vorfinden. Wenn auch weniger drastisch als Günter Grass, so doch in ähnlicher Richtung hat Ulrich Beck daraus den Schluss gezogen, dass die Globalisierung den Unternehmen und ihren
Verbänden zunehmend erlaubt, »die politisch und sozialstaatlich gezähmte Handlungsmacht des demokratisch organisierten Kapitalismus aufzuschnüren und zurückzuerobern« und dass »die Prämissen des Sozialstaates (...) ebenso wie die Staatskosten (und) das Steuersystem (...) unter der neuen Wüstensonne der Globalisierung in die subpolitische Gestaltbarkeit hineinschmelzen«. Der Frau und dem Mann auf der Straße tritt dies alles mit der
Geißel der Arbeitslosigkeit entgegen. Ob sie wirklich eine Auswirkung des Globalisierungsprozesses ist oder nicht, bleibe dahingestellt. Tatsache ist, dass den Menschen in den klassischen demokratischen Staaten ständig das Argument des Anpassungsdrucks entgegengehalten wird, der eben von dieser Globalisierung ausgehe. Das Gefühl wächst, es liege nicht mehr in den eigenen Händen,
das zu erreichen, wonach jeder Mensch strebt: gesichertes Auskommen im Beruf und im Alter, gute Erziehung für die Kinder, ein anständiges Dach über dem Kopf und eine gesunde Umwelt. Damit einher geht ein Vertrauensverlust gegenüber den demokratischen Institutionen. Kann es da überraschen, wenn so viele Autoren darüber nachsinnen, ob Marx und Engels nicht doch vor 150 Jahren mit ihrem Kommunistischen Manifest den Finger in die richtige Wunde gelegt haben? Eine solche Entwicklung darf diejenigen Unternehmer, die diesen Namen verdienen, nicht kalt lassen. Allzu leicht ist es, im Chor jener großen Mehrheit mitzuheulen, die »Profit, Profit« als Wunderheilmittel auf ihre Fahnen geschrieben hat; Nachdenken oder gar Handeln auf der Grundlage ethischer Verantwortung ist mühevoller. Mancher, der sich mit stolzgeschwellter Brust und vollem Portemonnaie vorgaukelt, er treibe die wirtschaftliche Entwicklung des eigenen
Unternehmens oder gar der Menschheit voran, trägt als Getriebener, als Gefangener eines Systems dazu bei, dass am Ende des Geschehens nicht Freiheit, Friede und Wohlstand für alle, sondern ein Rückschlag in Chaos und Auseinandersetzung stehen könnte. Das Zeitalter, in dem unternehmerische Verantwortung auf weit mehr zielt als nur auf die Vermögensmehrung der Anteilseigner, ist nicht zu Ende - es hat gerade erst begonnen.
Und nur diejenigen, die solches zu begreifen vermögen, dürfen sich als Treiber des Geschehens, als Unternehmer im Sinne des Wortes verstehen. Wahres Verantwortungsbewusstsein richtet sich unverändert auf mehr als nur die materiellen Interessen der Geldgeber: Es richtet sich auf die Menschen, die von den Unternehmen abhängig sind. Und es richtet sich auf das Wohl der Gemeinwesen, in denen die Unternehmen arbeiten. Nur wer
dies verstanden hat, wird dazu beitragen, jenes Ethos am Leben zu erhalten, das allein geeignet ist, unternehmerisches Wirken dauerhaft zu legitimieren. Den Rahmen für solche Verantwortung vorzugeben bleibt Aufgabe des Staates. Das ändert nichts an der Feststellung, dass niemand von uns eine Antwort darauf weiß, wie diese Aufgabe angesichts der Zwänge der Globalisierung im Detail gelöst werden kann. Es geht darum, gegenüber der Zügellosigkeit wirtschaftlicher
Egoismen den Primat des Politischen wiederherzustellen, der konstitutiv für die demokratische Staatsidee ist. Der Weg dahin wird beschwerlich sein. Womöglich wird er den Versuch einschließen müssen, mit weit größerer Zielstrebigkeit, als bisher erkennbar, sich um vertragliche Netzwerke zwischen den maßgeblichen Staaten zu bemühen. Mag sein, dass ich mich damit dem Vorwurf ewiggestriger
Staatsgläubigkeit aussetze. Aber wäre es wirklich von vornherein aussichtslos, den Einfluss der institutionellen Investoren und der dazugehörigen Junganalysten im Rahmen internationaler Abkommen in ein gesetzlich vorgegebenes Rahmenwerk einzuordnen? Ist es wirklich der Weisheit letzter Schluss, dem Druck der Interessenten nachzugeben und jegliche auch international wirksamen steuerlichen Sanktionen für kurzfristige Aktienspekulationen aufzuheben, statt sie auf
einigermaßen tolerable Haltefristen auszudehnen? Und wäre es nicht denkbar, das als unausweichlich beschworene Emporschießen der Honorierung von Managern durch staatliche Vereinbarungen vernünftig einzugrenzen? In den USA wird über diese Fragen längst diskutiert. Der Primat der Politik: Denjenigen Managern und Unternehmern, die noch Bücher lesen, sei auch im Zeitalter der Globalisierung, des Shareholder-Value und des vorgeblichen
Primats der Wirtschaft empfohlen, einen Blick in die Schriften von Max Weber oder Walther Rathenau zu werfen. Primat der Politik ist eine Überlebensfrage der Demokratie.  |