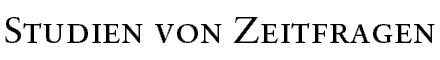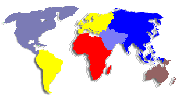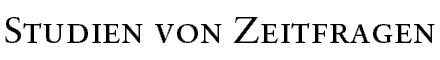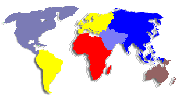Über Nutzen und Vorteil der Hirnforschung für die Geschichtswissenschaft:
Eröffnungsvortrag des 43. Historikertages
(Vom Original übernommen  ) )
Von Professor Dr. Wolf Singer,
Direktor des Max Planck-Instituts für Hirnforschung in Frankfurt am Main.
Dem Programm des Historikertags zu entnehmen, daß ein
Neurobiologe, also ein Vertreter einer sogenannten exakten naturwissenschaftlichen Disziplin den Eröffnungsvortrag hält, war für Sie vermutlich genauso überraschend wie für mich der Anruf, durch den ich zu diesem Abenteuer angestiftet wurde. Nehmen Sie also bitte das, was ich Ihnen jetzt vortragen werde, als das Ergebnis meines kollegialen Bemühens, zu erraten, was die Intentionen des Programmkomitees gewesen sein könnten.
Daß die Geschichtswissenschaften sich durch die Analyse von
Vergangenem und Nichtwiederholbarem auszeichnen und sich somit dem experimentellen Zugriff entziehen, ist kein Privileg dieser Disziplin. Man denke an die Kosmologie oder die Evolutionsbiologie. Auch dort muß im nachhinein ergründet werden, wie es sich vollzogen hat und warum so und nicht anders. Freilich sind die Vorgänge, für die sich Historiker interessieren, erst mit dem Menschen in die Welt gekommen, als dieser begann, der biologischen die kulturelle Evolution
hinzuzufügen - als das, was wir als Geschichte bezeichnen, seinen Anfang nahm. Aber auch diese Besonderheit teilt die Geschichtswissenschaft mit einigen Disziplinen, die sich den Naturwissenschaften verbunden fühlen, wie der Paläontologie und der Anthropologie.
Was also ist das Besondere an der Geschichtswissenschaft, das die Einmischung der Hirnforschung rechtfertigen könnte? Ich vermute, daß es in den Quellen zu suchen ist, aus denen die
Geschichtswissenschaft schöpft. Dabei sind nicht die direkt faßbaren Spuren gemeint, die Geschichte hinterläßt, die Bauwerke, Kulturlandschaften, Schlachtfelder, Ruinen und Gräber. Gemeint sind vielmehr die Zeugnisse, die bereits ihrerseits Ergebnis menschlicher Wahrnehmung, Erinnerung und Deutung sind - die in Bild- und Schriftsprache formulierten Berichte über Vorgefallenes, die Protokolle von Dabeigewesenen, die in Schriften und Bildern festgehaltenen
Erinnerungen von Augenzeugen und schließlich die weitererzählten, die zunächst mündlich überlieferten und dann irgendwann festgehaltenen Berichte, die von Menschen verfaßt wurden, die selbst nicht dabei waren. In der Geschichtswissenschaft geht es nicht um diese Berichte selbst, sondern um das Geschehen, über das berichtet wird, und darum, eine möglichst zutreffende Rekonstruktion zurückliegender Vorgänge zu erzielen.
Wir sehen, was zu sehen nützlich ist
Damit das historische Dokument von einer Wirklichkeit adäquat Zeugnis gibt, muß zunächst der Berichterstatter selbst in der Lage sein, das von ihm Wahrgenommene möglichst zutreffend und unmißverständlich auszudrücken. Und hier gibt es Übertragungsprobleme. Wir haben zwar nur fragmentarische Vorstellungen darüber, wie Wissen, wie Erinnerungen im Gehirn
repräsentiert sind, aber so viel scheint gewiß: Die Struktur der Engramme ist nicht sonderlich gut geeignet, um in Sätze rationaler Sprache umgesetzt zu werden. Wahrnehmungen und Erinnerungen haben holistischen Charakter, was in zeitlicher Abfolge erfahren wurde, liegt meist als gebündelter Gesamteindruck vor, dessen verschiedene Komponenten aufs innigste assoziativ miteinander verknüpft sind. Doch selbst wenn dem inneren Auge dieses komplexe Geflecht von Fakten,
Beziehungen und Bewertungen klar und transparent erscheint, erweist es sich in der Regel als schwierig, dieses parallel organisierte Wissen in eine Sequenz von logisch konsistenten Aussagen zu übersetzen. Und so nimmt nicht wunder, daß Menschen, wenn sie wirklich zu verstehen geben wollen, was wirklich war, auf Begegnungen bestehen. Diese eröffnen dann die Option, parallel zur rationalen Sprache auch die anderen Ausdrucksmöglichkeiten zu nutzen: Prosodie, Mimik, Gestik.
Historikern ist diese Möglichkeit oft benommen. Die Zeitzeugen leben meist nicht mehr.
Damit stellt sich die drängende Frage nach der Verläßlichkeit unserer Wahrnehmungen und Erinnerungen. Was wir wahrzunehmen in der Lage sind und wie wir wahrnehmen, ist durch die Natur der kognitiven Prozesse in unserem Gehirn festgelegt. Unser Gehirn wiederum ist Ergebnis eines evolutionären Prozesses, der über zufällige Mutationen und Wettbewerb Strukturen hervorgebracht hat, die sich in ihrem
jeweiligen Biotop behaupten konnten. Dies macht zwar wahrscheinlich, daß sich dabei kognitive Systeme herausgebildet haben, die Vorgänge in der Welt draußen möglichst genau zu erfassen erlauben. Es ist jedoch keine Garantie dafür, daß die Systeme daraufhin optimiert wurden, eine möglichst objektive Beurteilung der Welt zu liefern. Unsere Sinnessysteme wählen aus dem breiten Spektrum der Signale aus der Umwelt ganz wenige aus und dabei natürlich solche,
die für das Überleben in einer komplexen Welt besonders dienlich sind. Aus diesem wenigen wird dann ein kohärentes Bild der Welt konstruiert, und unsere Primärwahrnehmung läßt uns glauben, dies sei alles, was da ist. Wir nehmen nicht wahr, wofür wir keine Sensoren haben, und ergänzen die Lücken durch Konstruktionen. Erst die Verwendung künstlicher Sensoren lehrt uns, daß es da weit mehr wahrzunehmen gäbe.
Noch mehr eingeschränkt wird das, was wir von Augenblick zu
Augenblick wahrnehmen können, durch die begrenzte Kapazität jener Prozesse, auf denen bewußte Wahrnehmung beruht. In unserem Gehirn kommen fortwährend weit mehr Signale von den Sinnesorganen an, als uns bewußt ist. Viele von diesen Signalen werden auch bearbeitet, aber das Ergebnis dieser Analysen gelangt nicht ins Bewußtsein. Und so kommt es, daß Menschen, wenn sie nach Motiven für bestimmte Handlungen befragt werden und die wirklichen Motive auf solchen
unbewußten Prozessen beruhen, frisch erfundene Motive anbieten, ohne sich gewahr zu werden, daß diese Begründung unzutreffend ist.
Hieraus ergeben sich zwei wichtige Schlußfolgerungen für unser Problem: Erstens muß Begründungen von Handlungsmotiven mißtraut werden, und zwar nicht, weil der Befragte vorsätzlich lügen könnte, sondern weil er keine lückenlose bewußte Kontrolle über seine Motive haben kann. Zweitens, Menschen haben das unwiderstehliche Bedürfnis, Ursachen und
Begründungen zu finden für das, was sie tun.
Weil der Zugang zum Bewußtsein beschränkt ist, haben alle höher entwickelten Gehirne Mechanismen zur Steuerung der sogenannten »selektiven Aufmerksamkeit« entwickelt, mit denen sie aus der Fülle der ständig verfügbaren Signale jene auswählen können, die zu bewußter Verarbeitung gelangen sollen. Welche Ereignisse in der Lage sind, die selektive Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und damit erinnerbar zu
werden, hängt nun wiederum von einer Vielzahl von Faktoren ab. Zum einen ziehen auffällige Reize oder Ereignisse die Aufmerksamkeit ohne Zutun des Beobachters auf sich. Sie erzeugen besonders starke neuronale Antworten in der Hirnrinde, und diese beeinflussen dann direkt, gewissermaßen von unten herauf, die Mechanismen, welche die Aufmerksamkeit steuern. Es besteht jedoch auch die Option, die Aufmerksamkeit von sich aus zu lenken, wobei sowohl absichtsvolle als auch
unbewußte Faktoren zusammenwirken.
Bestehen bestimmte Erwartungen, richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Sinneskanäle, welche die erwarteten Ereignisse übertragen werden. Diese kommen dann bevorzugt, aber natürlich auf Kosten anderer Vorgänge zur Verarbeitung, die erwarteten Inhalte werden schneller verarbeitet, schneller identifiziert und gelangen dann meist auch bevorzugt ins Bewußtsein und in die Langzeitspeicher. Aber die zentrale
Steuerung der Aufmerksamkeit unterliegt auch unbewußten Einflüssen. So können unbewußt gebliebene Reize oder Erinnerungen Erwartungen auslösen, die selbst unbewußt bleiben, aber dennoch dafür sorgen, daß sich die Aufmerksamkeit bevorzugt auf bestimmte Sinnessignale richtet. Meist nehmen wir nur wahr, was wir ohnehin erwarten, und oft vereiteln auffällige, aber möglicherweise unbedeutende Reize die Wahrnehmung der leisen, aber vielleicht viel wichtigeren
Vorgänge. Die eigentliche Kunst der Zauberer besteht darin, genau diesen Mechanismus der Steuerung von Aufmerksamkeit auszunutzen. Welche fatalen Auswirkungen dieser biologische Mechanismus auf die Zuverlässigkeit der Berichte von Augen- und Zeitzeugen hat; bedarf keiner weiteren Kommentierung. Dem Überleben von Organismen ist dieser Mechanismus dienlich - sonst hätte er sich nicht entwickelt, denn es ist zweckmäßig, plötzlichen Änderungen im Strom der Sinnessignale
Aufmerksamkeit zuwenden zu können oder einen erwarteten Feind schnell und sicher zu erkennen - aber für die Zuverlässigkeit von menschenvermittelten historischen Quellen hat er mitunter katastrophale Folgen.
Die Wahrnehmungsprozesse selbst sind nicht weniger eklektisch, Wahrnehmung bildet nicht ab. Nur in pathologischen Fällen, wenn höhere Hirnfunktionen gestört sind, kommt es gelegentlich zu dem Phänomen der eidetischen Wahrnehmung,
einer nahezu fotografischen Erfassung komplexer visueller Szenen. Die Welt auf diese Weise wahrzunehmen ist jedoch in hohem Maß unökonomisch, und deshalb sind die normalen Wahrnehmungsprozesse ganz anders organisiert. Uns stellt sich Wahrnehmung als ein hochaktiver, hypothesengesteuerter Interpretationsprozeß dar, der das Wirrwarr der Sinnessignale nach ganz bestimmten Gesetzen ordnet und auf diese Weise die Objekte der Wahrnehmung definiert.
Nun ließe sich mit der Tatsache, daß Vorhandenes nicht wahrgenommen wird, noch umgehen, weil in den Berichten dann zwar unvollständige Beobachtungen geschildert werden, aber keine falschen Tatsachen. Viel problematischer wirkt sich dagegen aus, daß unser Wahrnehmungsapparat immer danach trachtet, stimmige, in sich geschlossene und in allen Aspekten kohärente Interpretationen zu liefern und für alles, was ist, Ursachen und nachvollziehbare Begründungen zu suchen. Man
stelle sich nun aber vor, das gleiche geschähe auf der Ebene der Bedeutungszuweisung oder der Zuschreibung von Kausalbezügen. Es würden dann aus gleichen Abläufen völlig verschiedene Schlußfolgerungen gezogen werden, oder, schlimmer noch, es könnten Ereignissen Bedeutungen zugeschrieben werden, die sie in Wirklichkeit nicht hatten. Ein triviales Beispiel ist unsere fast zwanghafte Tendenz, die zeitliche Kontingenz von Ereignissen als Ausdruck einer Kausalbeziehung wahrzunehmen.
Die Konstruktion solcher Beziehungen ist biologisch sinnvoll, da in der Tat die Wahrscheinlichkeit groß ist, daß Gleichzeitiges miteinander zu tun hat, entweder die gleiche Ursache hat oder sich wechselseitig bedingt. Solange die Bedingungen in der Welt einigermaßen konstant sind, stehen die Chancen nicht schlecht, daß trotz aller Unsicherheiten zutreffende Interpretationen gefunden werden, und deshalb hat vermutlich auch die Evolution diese Ergänzungsmechanismen
hervorgebracht. Aber fatal kann dieses Extrapolieren, Bedeutungszuweisen und Kausalbeziehungenkonstruieren werden, wenn diese Verfahren auf Prozesse angewandt werden, die anderen Gesetzen folgen als jenen, die der Beobachter und Interpret voraussetzt. Wie nun verhält es sich mit unserer Fähigkeit, Wahrgenommenes zu erinnern? Von den vielen Speicherfunktionen, die unser Gehirn erfüllt, interessieren hier vor allem zwei: das Kurzzeitgedächtnis, Arbeitsgedächtnis
genannt, und das episodische oder deklarative Gedächtnis. Im Kurzzeitspeicher, der im Frontalhirn verwaltet wird, halten wir vorübergehend fest, was uns für die gerade anstehenden Handlungsfolgen relevant erscheint, gerade nachgeschlagene Telefonnummern bis zur Beendigung des Wählvorgangs, Ort und Gestalt von Objekten, die wir manipulieren wollen, und so weiter. Es ist diese Gedächtnisfunktion, die uns die Erfahrung der Kontinuität von Zeit vermittelt und die Unterscheidung
zwischen »vorher« und »jetzt« ermöglicht. Bemerkenswert ist, daß die Kapazität dieses so wichtigen Speichers außerordentlich begrenzt ist. Es ist kaum möglich, mehr als etwa sieben verschiedene Inhalte gleichzeitig präsent zu halten, also etwa die siebenstelligen Telefönnummern in Großstädten. Kurzzeitspeicherung ist also noch eng mit dem Wahrnehmungsprozeß selbst verschränkt, hält gleichzeitig bereit, was sich nacheinander ereignet, und erlaubt so die
Herstellung von Bezügen und die Einordnung der Geschehnisse in einen zeitlichen Rahmen.
Sollen aber die Ereignisse dieser Wahrnehmungs- und Ordnungsprozesse auch noch nach Tagen oder Jahren erinnerlich sein, dann müssen sie in Langzeitspeicher überschrieben werden, und zwar in das episodische Gedächtnis, denn nur dieses macht es möglich, die Erinnerung an Ereignisse zusammen mit dem Kontext, in dem sie geschehen sind, wieder wachzurufen. Die Gedächtnisspuren
müssen wieder ins Bewußtsein gelangen. Ein viel zitiertes Beispiel für eine Leistung des episodischen Gedächtnisses ist die Fähigkeit, sich genau zu erinnern, wo man gewesen ist und was man gerade tat, als einen die Nachricht erreichte, Kennedy sei ermordet worden oder die Mondlandung sei geglückt.
Anders als beim einfachen Wiedererkennen von Wahrnehmungsobjekten, bei dem das Objekt die Gedächtnisspur reaktiviert, ist es bei episodischen
Gedächtnisleistungen erforderlich, daß Engramme, die weit verteilt in der Großhirnrinde abgelegt sind, willentlich aktiviert, ins Bewußtsein transferiert und dann im richtigen Kontext miteinander verbunden werden. Sind diese Systeme gestört, kann weder Neues gespeichert noch Zurückliegendes erinnert werden. Wir alle, vor allem wir Älteren, wissen um die Fragilität dieses Auslesesystems. Bemerkenswert ist dabei, daß die Festschreibung, die Konsolidierung von Spuren im episodischen
Gedächtnis offenbar sehr langsam über Monate, ja sogar Jahre hinweg zu erfolgen scheint. Bei Teilschädigungen der Speicher- und Auslesemechanismen gehen vorrangig die Erinnerungen an die jüngere Vergangenheit verloren, nicht die weit zurückliegenden - entsprechend bleiben die jüngst abgespeicherten Erinnerungen suszeptibel für Modifikationen und Überformungen durch aktuell Erlebtes. Evolutionsgeschichtlich sind diese Strukturen des episodischen
Gedächtnisses identisch mit denen, die es Tieren erlauben, sich in ihrem Habitat zurechtzufinden. Somit findet unser episodisches Gedächtnis eine evolutionäre Deutung: Es war primär ein Gedächtnis für Orte und deren Beziehung zueinander.
Wie sehr die vermeintliche Wirklichkeit erinnerter Sachverhalte tatsächlich auf Rekonstruktionen von Beziehungen zwischen bruchstückhaften und voneinander getrennten Gedächtnisspuren beruht, läßt sich aus häufig vorkommenden
Fehlern erschließen. Man erinnert sich an eine Aussage, weiß aber nicht, von wem sie in welchem Kontext geäußert wurde. Gelegentlich erlebt man sogar Einsichten als seine eigenen, obgleich man sie der Aufklärung durch andere verdankt, weil man keinerlei Erinnerung an den verursachenden Lernprozeß mehr hat. Eine vermutlich häufige Ursache für das, was dann als Plagiat angeprangert wird.
Erinnerung ist also für die gleichen Deformationsprozesse
anfällig wie die Primärwahrnehmung selbst. Ich meine damit noch nicht das Vergessen, das dem »Nicht-Wahrnehmen« vergleichbar ist, sondern die Fehler, die beim Rekonstruktionsprozeß des Erinnerns unterlaufen können. Die Freiheitsgrade für die synthetischen Bemühungen des inneren Auges sind beträchtlich. Es stehen keine äußeren Zeitmarken zur Verfügung für die Reihung von Ereignissen. Auch kann unvollkommen Wahrgenommenes nicht durch nochmaliges
Hinschauen ergänzt werden. Und so nimmt nicht wunder, daß beim Erinnern nur schwer zu trennen ist, welche Inhalte und vor allem welche Bezüge zwi-chen denselben bereits im Zuge des Wahrnehmungsaktes abgespeichert wurden und welche erst beim Auslesen und Rekonstruieren definiert oder gar hinzugefügt wurden.
Jedes Erinnern findet in der Gegenwart statt
Wie nahe Erinnerung erneuter Wahrnehmung kommt, zeigen
jüngste neurobiologische Entdeckungen auf beunruhigende Weise. Ich hatte oben erwähnt, daß Abspeichern langsam erfolgt und Engramme der Konsolidierung bedürfen. Dies hat zur Folge, daß Gedächtnisspuren vollkommen ausgelöscht werden können, wenn innerhalb von Stunden, ja sogar Tagen nach dem Lernprozeß der Konsolidierungsprozeß gestört wird. Im Experiment wird dies meist durch die Unterbrechung der Eiweißsynthese in Nervenzellen erreicht. Und nun die völlig
unerwartete Entdeckung: Tiere erlernten in einem Verhaltenstest, daß bestimmte Erkenntnisleistungen belohnt werden, und wiederholte Testung bestätigte, daß sich die Tiere monatelang mit nur geringen Vergessensraten an den gelernten Zusammenhang erinnerten. Dann wurde nach einem dieser Tests die Eiweißsynthese vorübergehend blockiert, und das überraschende Ergebnis war, daß die Tiere im Anschluß daran jede Erinnerung an das einmal Gelernte verloren hatten.
Diese Auslöschung der Erinnerung trat jedoch nicht ein, wenn die Eiweißsynthese ohne vorherige Testung und zum gleichen Zeitpunkt nach dem ursprünglichen Lernprozeß unterbrochen wurde.
Dies bedeutet, daß durch das Erinnern, zu welchem die Tiere während der Testung angehalten waren, die bereits befestigten Gedächtnisspuren wieder labil wurden und dann wieder der gleichen Konsolidierung bedurften wie die ursprünglichen Engramme nach dem ersten Lernprozeß. Unter
normalen Bedingungen fällt dieser erneute Konsolidierungsprozeß nicht auf, weil er ungestört und verläßlich abläuft. Es bedeutet dies jedoch, daß Engramme nach wiederholtem Erinnern gar nicht mehr identisch sind mit denen, die vom ersten Lernprozeß hinterlassen wurden. Es sind die neuen Spuren, die bei der Testung, also beim Erinnern, erneut geschrieben wurden.
Das hat weitreichende Konsequenzen für die Beurteilung der Authentizität von Erinnerungen. Wenn Erinnern immer auch
einhergeht mit Neu-Einschreiben, dann muß die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, daß bei diesem erneuten Konsolidierungsprozeß auch der Kontext, in dem das Erinnern stattfand, mitgeschrieben und der ursprünglichen Erinnerung beigefügt wird. Es ist dann nicht auszuschließen, daß die alte Erinnerung dabei in neue Zusammenhänge eingebettet und damit aktiv verändert wird. Sollte dies zutreffen, dann wäre Erinnern auch immer mit einer Aktualisierung der Perspektive
verbunden, aus der die erinnerten Inhalte wahrgenommen werden. Die ursprüngliche Perspektive würde überformt und verändert durch all die weiteren Erfahrungen, die der Beobachter seit der Ersterfahrung des Erinnerten gemacht hat. Was schon für die Mechanismen der Wahrnehmung zutraf, scheint also in noch weit stärkeren Maß für die Mechanismen des Erinnerns zu gelten. Sie sind offensichtlich nicht daraufhin ausgelegt worden, ein möglichst getreues Abbild dessen zu
liefern, was ist, und dieses möglichst authentisch erinnerbar zu halten.
Zum Abschluß noch einige Bemerkungen zum Vergessen. Die Natur der Speicherprozesse im Gehirn stützt die Vermutung, daß unter nichtpathologischen Bedingungen einmal Gespeichertes nicht spurlos verschwinden kann. Das liegt daran, daß neuronale Speicher als Assoziativspeicher ausgelegt sind, in denen Inhalte als dynamische Zustände weitverteilter, miteinander vernetzter Nervenzellverbände definiert sind und
nicht wie in Computern einen adressierbaren Speicherplatz belegen. Ferner geht das Einschreiben von Engrammen mit mikrostrukturellen Veränderungen einher, die immer eine sehr große Zahl von Nervenzellen und deren Verbindungen gleichzeitig betreffen. Es ist deshalb sehr unwahrscheinlich, daß durch den Ausfall einzelner Nervenzellen oder durch nachträgliche Veränderungen der Verbindungen bestimmte Gedächtnisinhalte selektiv gelöscht werde. Was jedoch bei
Assoziativspeichern zum Problem wird, ist das Überschreiben des Alten durch Neues. In Assoziativspeichern werden durch Lernprozesse Gruppen von Neuronen in immer neuen Konstellationen zusammengebunden, deren gemeinsame Aktivierung dann die Repräsentation für den jeweiligen Gedächtnisinhalt darstellt. Die gleichen Nervenzellen beteiligen sich also an der Repräsentation sehr viel verschiedener Inhalte, was sich ändert, ist lediglich die Konstellation, in der sie aktiv
werden. Dies aber hat zur Folge, daß mit der Zeit einzelne Nervenzellen an der Repräsentation von immer mehr unterschiedlichen Inhalten partizipieren müssen.
Damit wird es immer schwieriger, die einzelnen Inhalte voneinander zu trennen. Auch können dabei die Stabilität und die Präzision bereits bestehender Repräsentationen abnehmen. Erinnerungen sind dann nur noch bruchstückhaft abrufbar oder verschwimmen wie defokussierte Bilder, wenn zu viele
Neuronen aus diesen ursprünglichen Repräsentationen durch nachfolgendes Lernen in andere, neue Repräsentationen eingebunden werden. Wer verwandte Sprachen sequentiell erlernt hat, weiß, wie sehr die neue die alte überdeckt, wie groß die Gefahr ist, daß es zu Konfusionen kommt, weil alte und neue Inhalte miteinander verschmelzen.
Datengestützte Erfindungen
Eine wichtige Qualität von Assoziativspeichern wird hier zum
Problem: Assoziativspeicher haben die erwünschte Eigenart, Teilinformationen zu ergänzen und zu rekombinieren. Dies ermöglicht die Wiedererkennung von Objekten, auch wenn diese nur ausschnittweise wahrzunehmen sind. Solche Ergänzungs- und Bindungstendenzen können jedoch die fatale Folge haben, daß einmal Eingespeichertes durch jeden weiteren Speicherprozeß, vor allem wenn dieser ähnliche Inhalte betrifft, in seiner Struktur und kontextuellen Einbettung verändert wird.
Im Extremfall kann das dazu führen, daß das Engramm überhaupt nicht mehr im ursprünglichen Kontext aktivierbar ist. Es scheint dann wie vergessen, kann aber dann dennoch - und dann meist zur Überraschung der Beteiligten - in einem veränderten Kontext über neue Assoziationen wieder aktiviert werden. Die Erinnerung lebt wieder auf, aber jetzt in einem anderen narrativen Kontext. Unter nichtpathologischen Bedingungen geht also vermutlich nichts vollkommen und unwiderruflich verloren.
Wahrnehmungen und Erinnerungen sind also datengestützte Erfindungen. Und weil diese Erfindungen konstitutiv sind für unsere kognitiven Prozesse und nicht Folge vorsätzlichen Täuschenwollens, ist es schwierig zu entscheiden, welchen Berichterstattern wir mit Nachsicht begegnen sollen.
Was kann dies für die Erforschung der Geschichte bedeuten? Nicht nur die Taten, sondern auch die Geschichten, die Menschen erfinden, machen Geschichte. Zur Geschichte gehören
nicht nur die Wirklichkeiten, die aus der Dritten-Person-Perspektive behandelt werden können, die Vorfälle selbst, sondern auch die Phänomene, die erst durch die reflektierende und konstruktivistische Tätigkeit unserer Gehirne in die Welt kommen. Auch wenn diese Wirklichkeiten erst über kognitive Prozesse entstehen, also mentale beziehungsweise soziale Realitäten sind, so sind sie deshalb nicht weniger geschichtsbestimmend als die konkreten Vorfälle. Geschichte
hat demnach die charakteristischen Eigenschaften eines selbstreferentiellen, ja vielleicht sogar evolutionären Prozesses, in dem alles untrennbar miteinander verwoben ist und sich gegenseitig beeinflußt, was die Akteure des Systems, in unserem Fall die Menschen, hervorbringen - ihre Taten, Wahrnehmungen, Erinnerungen, Empfindungen, Schlußfolgerungen und Bewertungen -, und natürlich auch die Geschichten, die sie unwissentlich fortwährend erfinden. Ein
Prozeß also, in dem es keine sinnvolle Trennung zwischen Akteuren und Beobachtern gibt, weil die Beobachtung den Prozeß beeinflußt, selbst Teil des Prozesses wird. Und so scheint mir, daß es weder die Außenperspektive noch den idealen Beobachter geben kann, die beide erforderlich wären, um so etwas wie die eigentliche, die wahre, die tatsächliche Geschichte zu rekonstruieren. Wenn dem so sein sollte, dann können wir im Prinzip nicht wissen, welcher der möglichen
Rekonstruktionsversuche der vermuteten »wahren« Geschichte am nächsten kommt. Und so wird jeweils in die Geschichte als Tatsache eingehen, was die Mehrheit derer, die sich gegenseitig Kompetenz zuschreiben, für das Zutreffendste halten. Unbeantwortbar bleibt dabei, wie nahe diese Feststellungen der idealen Beschreibung kommen, weil es diese aus unserer Perspektive nicht geben kann. 
|